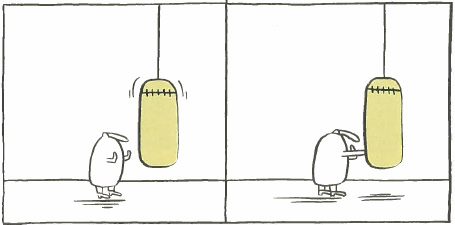Historisches
Während Musik- oder Maltherapien hierzulande schon lange selbstverständlich zum Einsatz kommen, haftet der Bibliotherapie noch immer etwas Exotisches an. Dabei gehörten schon in der Antike Literatur und Heilung zusammen: Apollon ist der Gott der Ärzte und Poeten, und Aristoteles lobt in seiner Theorie der Katharsis die reinigende Funktion, die Furcht und Mitleid in der Tragödie auslösen. Im Mittelalter zirkulierten nebst religiösen Texten vor allem Spruchbüchlein, um das Unbenennbare zu benennen und damit zu verbannen, und Trostbücher, die einerseits zur Entlastung des Schreibenden dienten, aber auch gezielt für Menschen in Not, Leid und Verzweiflung geschrieben wurden.
Erst im 19. Jahrhundert jedoch begann man in der Krankenbehandlung systematisch mit Literatur zu arbeiten, als nämlich in den Spitälern Patientenbibliotheken eingerichtet wurden. Zwei amerikanische Psychoanalytiker und Psychiater – Arthur Lerner und Jack Leedy – trugen schliesslich in den 1960er-Jahren dazu bei, dass die Bibliotherapie heute in den USA an verschiedenen Universitäten und Instituten gelehrt wird.
Die Patienten werden mit Hilfe der Poesietherapie spontaner und kreativer. Die Poesie gehört zu den stärksten Ausdrucksmöglichkeiten des Menschen und setzt dadurch im Hörer oder Leser tiefe Emotionen frei. Das Gedicht wird oft als die kürzeste emotionale Verbindung zwischen zwei Punkten, dem Dichter und dem Leser, bezeichnet. Dies erklärt vielleicht, warum Kommunikation sich über Poesie so leicht herstellen lässt und warum Patienten sich so häufig zu eigenen Gedichten anregen lassen.
Jack Leedy, Prinzipien der Poesietherapie (1985)